Gewalt gegen Menschenrechtsverteidiger:innen in Brasilien
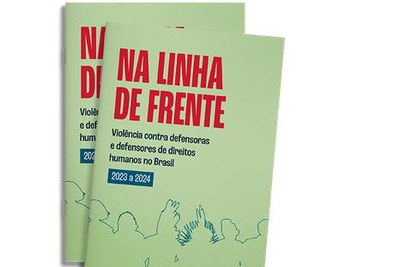
Die beiden brasilianischen Menschenrechtsorganisationen Justiça Global und Terra de Direitos haben eine neue Version ihres bereits seit mehreren Jahren erscheinenden Menschenrechtsbericht der Reihe "Na linha de frente" der Öffentlichkeit vorgestellt, diesmal mit Daten zu den Jahren 2023 und 2024 und zu der konkreten Frage von Gewalt gegen Menschenrechtsverteidiger:innen in Brasilien. Die neue Studie "Na Linha de Frente — Violência contra Defensoras e Defensores de Direitos Humanos no Brasil (2023–2024)" (hier bei Justiça Global und hier bei Terra de Direitos) erfasste 318 Gewalttaten, die 486 Opfer forderten – darunter 364 Einzelpersonen und 122 Kollektiven wie ganze Gemeinschaften, soziale Bewegungen und Organisationen.
Im Rückblick der historischen Reihe der Jahre 2019 bis 2024 verzeichnete Brasilien demnach "insgesamt 1.657 Fälle von Gewalt. Zwischen 2023 und 2024 wurden allein in den ersten beiden Jahren der aktuellen Regierungszeit 55 Morde, 96 Mordanschläge, 175 Morddrohungen und 120 Fälle von Kriminalisierung identifiziert. Bei vielen kollektiven Angriffen war es nicht möglich, die genaue Anzahl der betroffenen Personen zu ermitteln, was darauf hindeutet, dass die tatsächliche Zahl der Opfer noch höher sein könnte", so die beiden Menschenrechtsorganisationen in ihrer Analyse. Errechnet man aus den Zahlen für das Jahr 2024 registrierten Fälle die Häufigkeit der Menschenrechtsverletzungen gegen Menschenrechtsverteidiger:innen, so komme man im Durchschnitt auf die erschreckende Zahl von allen 36 Stunden, in denen eine Person wegen ihres Einsatzes für die Menschenrechte Opfer von Gewalt in Brasilien wird. "Bei der Erstellung dieser zweiten Ausgabe haben wir festgestellt, dass die Gewalt gegen Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidiger weiterhin fortbesteht", so Darci Frigo, Geschäftsführer von Terra de Direitos, anlässlich der Veröffentlichung des Berichts Ende vergangener Woche. Es reiche nicht aus, dass nur ein Bereich der öffentlichen Hand, beispielsweise die Bundesregierung, sich für die Verteidigung der Menschenrechte einsetze. Die Studie zeige, dass es andere Akteur:innen – öffentliche als auch private – gäbe, die vor Ort tätig sind, wie regionale oder lokale politische Kräfte, die dahingehend agieren würden, Fortschritte in der Menschenrechtspolitik und -praxis zu blockieren. Dies indem sie die Kriminalisierung durch die Justiz in die Wege leiten oder dass Gewalt durch bewaffnete Banden oder durch die Militärpolizei ausgeübt werde. Neu sei das Eindringen der organisierten Kriminalität in die Gebiete, so Darci Frigo.
Die Studie zeige, so Justiça Global und Terra de Direitos, dass ländliche Milizen, das organisierte Verbrechen und staatliche Akteure – wie die Militär- und Zivilpolizei – an verschiedenen Verstößen beteiligt waren. In 45 Fällen waren Militärpolizisten die Täter der Gewalttaten und für mindestens fünf Morde verantwortlich. Die meisten Opfer setzten sich für den Schutz von Land, Territorium und Umwelt ein – ein Thema, das in 87 Prozent der Morde eine Rolle spielte. Bei 78,2 Prozent dieser Verbrechen wurden Schusswaffen verwendet. Von den 486 zwischen 2023 und 2024 erfassten Fällen von Gewalt richteten sich der Erhebung zufolge 80,9 Prozent gegen Personen, die sich für den Schutz der Umwelt und des Territoriums einsetzen, also genau diejenigen, die direkt mit den Auswirkungen der Klimakrise konfrontiert seien, so Justiça Global und Terra de Direitos. Indigene Führungskräfte, Quilombolas sowie Bäuerinnen und Bauern gehörten zu den Hauptzielen der Angriffe auf Leib und Leben der Betroffenen.
Von den 55 Morden, die in dem Untersuchungszeitraum registriert wurden, waren der Studie zufolge 78 Prozent der Opfer cisgeschlechtliche Männer, 36,4 Prozent waren afrobrasilianisch und 34,5 Prozent indigen. Nur 9,1 Proznet der ermordeten Personen waren weiß, was den selektiven, rassistischen und strukturellen Charakter der Gewalt offenbare, so Justiça Global und Terra de Direitos. Die meisten Verbrechen ereigneten sich in ländlichen Gebieten und traditionellen Territorien, wo die bedrohten Menschenrechtsverteidiger:innen den Interessen von Landbesetzern, Großfarmer:innen und Großunternehmen entgegenstünden.
Auch Frauen sind weiterhin Zielscheibe von Angriffen, so Justiça Global und Terra de Direitos. Der Bericht identifizierte demnach 12 Morde an Menschenrechtsverteidigerinnen – 10 cis-Frauen und 2 Transfrauen. "Der Fall der Yalorixá und Quilombola-Führerin Mãe Bernadete, die trotz offizieller Schutzmaßnahmen in ihrem Haus mit 25 Schüssen ermordet wurde, verdeutlicht das hohe Risiko, dem schwarze, indigene und LGBTQIAPN+-Frauen in politischen oder spirituellen Führungspositionen ausgesetzt sind", so Justiça Global und Terra de Direitos.
In Bezug auf die regionale Analyse zeige die Studie, dass der Bundesstaat Pará mit 103 registrierten Fällen die nationale Rangliste der Gewalt gegen Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidiger anführe. "Davon richteten sich 94 Prozent gegen Personen, die sich für den Schutz der Umwelt und der Territorien einsetzen – also genau diejenigen, die für den Erhalt Amazoniens kämpfen", so Justiça Global und Terra de Direitos. Und: "Der Bundesstaat, der 2025 Gastgeber der COP30, der globalen UN-Klimakonferenz, sein wird, ist auch derjenige, in dem die meisten Angriffe auf Menschenrechtsverteidiger verübt werden."
Trotz des auch von den beiden Menschenrechtsorganisationen der aktuellen brasilianischen Bundesregierung attestierten politischen Willens zum Schutze der Menschenrechtsverteidiger:innen (wie beispielsweise bei der Reaktivierung von Ministerien und partizipativen Räten, die sich mit Menschenrechten befassen), so hebt der Bericht von Justiça Global und Terra de Direitos jedoch auch hervor, dass es der öffentlichen Schutzpolitik noch an Struktur, Budget und Wirksamkeit mangele. Die interministerielle Arbeitsgruppe Sales Pimenta, die gegründet wurde, um einen Plan zur Ausrichtung der Nationalen Politik zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern (PNPDDH) zu erstellen, spiele in diesem Prozess eine strategische Rolle. Es sei enorm wichtig, "die Umsetzung des im Dezember 2024 an das Ministerium für Menschenrechte und Staatsbürgerschaft übermittelten Plans fortzusetzen und zu beschleunigen. Die Veröffentlichung des Plans in Form eines Dekrets wird seitdem erwartet, wobei die Bundesregierung noch keinen Termin dafür bekannt gegeben hat", so Justiça Global und Terra de Direitos. "Es ist wichtig, dass Brasilien die öffentliche Schutzpolitik stärkt, indem es ein nationales System zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern institutionalisiert und vor allem die Ermittlungen und die Strafverfolgung von Personen vorantreibt, dass die Verbrechen wie Drohungen, Morde, Anschläge und anderen Straftaten verfolgt werden und damit der gravierenden Straflosigkeit entgegengewirkt wird", erklärte Sandra Carvalho, Mitbegründerin und Koordinatorin des Programms zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern und der Demokratie von Justiça Global. Zudem empfehlen die beiden Menschenrechtsorganisationen angesichts der anhaltenden Gewalt die operative Institutionalisierung des Nationalen Plans zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern mit koordinierten Maßnahmen zwischen den Gewalten der Republik, den Bundesstaaten und der kommunalen Ebene. Darüber hinaus fordert die Studie von der brasilianischen Regierung die vollständige Einhaltung des Escazú-Abkommens, eines internationalen Vertrags, der sich mit dem Zugang zu Informationen, der Beteiligung der Öffentlichkeit und dem Schutz von Umweltaktivist:innen in Lateinamerika und der Karibik befasst. Brasilien ist Unterzeichner des Abkommens, muss jedoch noch Fortschritte bei dessen wirksamer Umsetzung erzielen, so Justiça Global und Terra de Direitos.

